

„Die therapeutische Beziehung in der digitalen Welt“ war das Thema der 43. internationalen Fachtagung für Konzentrative Bewegungstherapie, die zum dritten Mal im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden stattfand.
Ute Backmann betonte in ihren eröffnenden Worten vor 86 Tagungsteilnehmer*innen die besondere Brisanz dieser Thematik - gerade für Therapeut*innen einer körperorientierten Therapiemethode.


Welche Auswirkungen hat die zunehmende Digitalisierung auf die therapeutische Beziehung – insbesondere für KBT-Therapeut*innen? Wo liegen Risiken oder vielleicht auch neue Möglichkeiten? Im Namen der Vorbereitungsgruppe (Barbara Bayerl, Marie-Louise Redel und Anke Hamacher-Erbguth) führte Barbara Bayerl in das Tagungsthema ein und machte neugierig auf Vorträge und Workshops, die eine komplexe Auseinandersetzung mit der Thematik in Aussicht stellten.
Den Eröffnungsvortrag „Vom Steinzeitmenschen zum Smartphoneuser - Gesund bleiben in einer immer komplexeren digitalen Welt“ hielt Prof. Dieter Braus, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie an den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden.

verpassen (FOMO „Fear of missing out“) oder die Belastung durch zu viel Informationen bei Angsterkrankungen (Cyberchondrie).
Ein besonderes Augenmerk legte Prof. Braus auf entwicklungspsychologische Aspekte. So entständen ernsthafte Bindungsverluste, weil Mutter oder Vater ihre Aufmerksamkeit in Gegenwart des Kindes überwiegend auf ihr Handy richteten. Kinder gerieten unter Stress, weil sie – biologisch eigentlich Steinzeitmensch und auf seltene Belohnungsreize programmiert – durch die ständigen Belohnungsreize bei Onlinespielen überfordert seien.
Als ausgleichendes Element zur digitalen Überflutung stellte der Referent ein „Natürliches Anti-Stress-Programm“ vor. Dabei spielen unter anderem Bewegung, Naturerfahrung, Schlaf, soziale Unterstützung, Rituale, Achtsamkeit und Entspannung eine Rolle.
Wie sehr die Thematik des Vortrags den Nerv der Zuhörer*innenschaft getroffen hat, wurde in der anschließenden Diskussion deutlich.
Am Donnerstagabend fand ein sehr gut besuchtes Treffen der Weiterbildungskandidat*innen statt. Sabine Wessendorf übernimmt mit Unterstützung von Nina Freudenberg die Leitung der Weiterbildungskommission von Evelyn Schmidt. Sprecherinnen der Weiterbildungskandidat*innen sind Petra Krüger und Annette Maass-Fust.
Erstmalig auf dieser Jahrestagung fand ein Treffen der im Verein tätigen Mentor*innen statt. Der lebendige Austausch zwischen „alten Hasen“ und Kolleg*innen, die sich gerade in die Mentor*innentätigkeit einarbeiten, wurde als sehr konstruktiv erlebt.
Die Referentin des zweiten Vortrags „Spezifika und Wirksamkeit der therapeutischen Allianz im internet-basierten Therapiesetting“, Dr. Maria Böttche leitet die Forschungsabteilung des Zentrums ÜBERLEBEN in Berlin mit den Forschungsschwerpunkten Traumafolgestörungen und Psychopathologie bei geflüchteten Menschen. Die therapeutische Arbeit der Abteilung erfolgt über Briefe zwischen Therapeut*in und Patient*in, die über eine geschützte Internetplattform übermittelt werden.
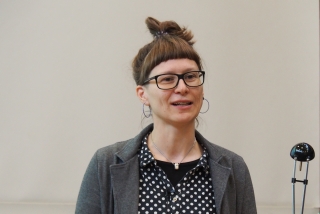
beiden Fallbeispielen der Referentin deutlich. Frau Dr. Böttche berichtet über das Projekt ihrer Doktorarbeit „Lebenstagebuch Therapie“ und gibt einen bewegenden Einblick in die Briefe weltkriegstraumatisierter Kinder – Menschen, die heute um die 80 Jahre alt sind. Es wird spürbar, wie behutsam ein tragender Kontakt zwischen Therapeutin und Patientin über das geschriebene Wort entstanden ist.
Das seit 2008 bestehende arabischsprachige Therapieprogramm gibt vielen Menschen in durch Krieg und Vertreibung aussichtslosen Lebenssituationen einen Zugang zur Therapie – was der Brief eines Mannes, der die Inhaftierung in einem arabischen Gefängnis überlebt hat, berührend belegt.
Nach dem Vortrag entwickelte sich eine lebhafte Diskussion über Resonanz in der therapeutischen Beziehung.
Unter dem Motto „Stadt-Land-Fluss“ - Ein „offline“-Nachmittag für Sinne und Bewegung“ fand sich am Freitagnachmittag eine große Gruppe Kolleg*innen zu einem Ausflug mit der ältesten deutschen durch Wasserlast betriebenen Drahtseilbahn auf Wiesbadens Hausberg, den Neroberg ein. Es war Zeit den Ausblick auf Wiesbaden zu genießen, die russisch-orthodoxe Kirche mit den goldenen Türmen zu besichtigen, zu wandern und Kaffee zu trinken. Ein wunderschöner Nachmittag – mal ganz offline.


Am Freitagabend fand die EAKBT Generalversammlung statt, die sich in diesem Jahr reger Teilnahme erfreute.

(Vizepräsidentin) und Rosemarie Gässler (Kassenwartin) in ihrem Amt bestätigt. Die Versammlung klang an einem bunten Buffet mit Snacks aus den sieben Mitgliedsländern gesellig aus.
Roland Brückl, Lehrbeauftragter im DAKBT mit langjähriger Erfahrung in Klinik und eigener Praxis referierte am Samstag zum Thema „Kann Konzentrative Bewegungstherapie digital?“
Der Vortrag wurde nicht zuletzt deshalb mit Spannung erwartet, weil der Referent das Auditorium bat, das eigene Handy mitzubringen.

In Rahmen seiner therapeutischen Tätigkeit machte Roland Brückl häufig die Erfahrung,
dass digitale Medien in der Beziehungsgestaltung vieler Menschen eine immer größere Rolle spielen. So macht es in seinen Augen Sinn, diesem Aspekt bereits zu Beginn der Therapie Raum zu geben.
Mit Fotos aus Therapiegestaltungen aus dem Einzel- und Gruppensetting wurde deutlich, dass Fragen wie „Welchen Raum nehmen digitale Medien in ihrem Leben ein?“, einen sehr bedeutsamen Aspekt der Lebensrealität von Patient*innen abbilden können – und wie wichtig es für KBT-Therapeut*innen sein kann, ausrangierte Handys und Laptops in ihren Fundus an Gegenständen aufzunehmen.
Eine Liveumfrage über ein Umfrage-Tool, an dem die Zuhörer*innen sich mit ihren eigenen Handys beteiligen konnten, machte deutlich, dass die teilnehmenden Kolleg*innen durchaus aufgeschlossen für eine Öffnung z.B. der KBT Weiterbildung für Themen aus der digitalen Welt sind.


„Könnte KBT über einen Messengerdienst funktionieren?“ - Zu dieser spannenden Frage nahm der Referent sein Publikum in einem experimentellen Rollenspiel zusammen mit seiner Kollegin Nina Freudenberg mit.
An den Vortrag schloss sich eine lebendige Diskussion an. Mit großer Freude nahm das Publikum die Ankündigung auf, dass der Vortrag in einer der nächsten Zeitschriften zu lesen sein wird.
Am Samstagnachmittag fand die Mitgliederversammlung des DAKBT statt. Mit viel Applaus taten die Mitglieder zu Beginn ihre Anerkennung für Uschi Schönberger und Birgit Rosa kund, den beiden Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle, die allen Mitgliedern des Vereins das ganze Jahr über mit Rat und Tat zur Seite standen.
Mit einer Schweigeminute wurde die kürzlich verstorbene Ali Maußhardt geehrt, früher im Vorstand und zuletzt langjährige Ombudsfrau des DAKBT.

Die bei der letzten Mitgliederversammlung ins Leben gerufene AG Zukunftswerkstatt stellte ihre Arbeit vor und lud zur Zukunftswerkstatt am 28./29.2.20 nach Bad Honnef ein.
Die AG Öffentlichkeitsarbeit hat im vergangenen Jahr einen „Styleguide“ entwickelt, eine Möglichkeit für alle Mitglieder das KBT-Logo im internen Bereich der Homepage herunterzuladen. So wird ein einheitliches Erscheinungsbild in der Außendarstellung möglich.

Die AG Weiterentwicklung der Lehre erarbeitete ein berufsbegleitendes Curriculum, das 90 Credit-Points entspricht. Im Augenblick wird nach einer Hochschule zur Kooperation gesucht. Die Zusammenarbeit mit der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin läuft weiterhin sehr gut.
Die Forschungsgruppe warb für ihr aktuelles Forschungsprojekt „Wirksamkeit der Gruppenbehandlung mit Konzentrativer Bewegungstherapie (KBT) aus Patient*innensicht. In Kliniken tätige Kolleg*innen sind eingeladen, sich daran zu beteiligen.
Der Vorstand des DAKBT wurde neu gewählt. Rosemarie Gässler stellte sich nicht mehr zur Wahl und wurde mit Bedauern und viel Wertschätzung aus dem Vorstand verabschiedet.


Ute Backmann wurde mit großer Mehrheit wieder, Waltraud Betker und Rudolf Kost neu in den Vorstand gewählt. Der neue Vorstand wurde mit großem Applaus in seinem Amt begrüßt.
Sylvia Keller-Kropp ist neue Ombudsfrau des DAKBT.
Die nächste Jahrestagung findet vom 15. bis 18.10.2020 in Wiesbaden statt, die Tagung 2021 Anfang Oktober in Salzburg.

Den letzten Vortrag der Tagung „Neue Medien – Neue Süchte? Ein Überblick über Verhaltenssüchte“ hielt am Sonntag Dr. Ekaterini Georgiadou, Psychologische Leitung der Sprechstunde für Verhaltenssüchte in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Nürnberg.

mit einer kaufsüchtigen Frau machte den Umfang der Problematik deutlich. Die Referentin erzählte von sehr guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit einer KBT- Therapeutin und lud die Zuhörerschaft zu Überlegungen ein, welchen wirksamen Beitrag die KBT in der Therapie von Verhaltenssüchten leisten könnte.
Abgerundet wurde die Tagung durch ein inspirierendes und kommunikatives Großgruppenangebot, geleitet von Silvia Keller-Kropp. Unter der Überschrift „KBT 2.0. Was geht? Was bleibt? Was kommt dazu?“ trafen sich wechselnde Kleingruppen zu Fragen wie „Was hat dich erreicht /berührt?“ oder „Was ich in meine (KBT-) Praxis einfließen lasse, ausprobiere …“. Es war Zeit für persönliche Reflexion, den Austausch mit Kolleg*innen und das Entwickeln neuer Ideen.






Bericht: Karin Hartwig Fotos: Kathinka Kintrup
Die Körperschemastörung ist ein zentrales Symptom der Anorexia nervosa. Die vorliegende Publikation verdeutlicht wie mit dem BID-CA Test das Ausmaß der Wahrnehmungsverzerrung (T1) und die Veränderungen am Ende der Behandlung (T2) erfasst werden können.
Hier der Link zum Artikel:
Perceptive Body Image Distortion in Adolescent Anorexia Nervosa: Changes After Treatment
In der Traueranzeige wird Ali Maußhardt charakterisiert:
„Den Menschen zuhören, sie ernstnehmen, Brücken bauen, Vertrauen haben in das Schicksal jedes Einzelnen“.
So haben wir unser Ehrenmitglied Ali Maußhardt auch im DAKBT kennen gelernt. Sie war immer zur Stelle, wenn sie im DAKBT gebraucht wurde.
Ali Maußhardt gehörte zu den Gründungsmitgliedern des DAKBT im Jahr 1975. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass aus einem losen Arbeitskreis der DAKBT e.V. wurde. Ihre langjährige parlamentarische Erfahrung kam somit uns allen zu gute. Von 1985 bis 1990 war sie Mitglied des Vorstands.
In dieser Zeit, in der Rudolf Kost und ich ebenfalls im Vorstand waren, hat sie uns behutsam und zugleich klar strukturiert begleitet. Ab und zu auch davor bewahrt, das Rad neu erfinden zu wollen.
Lange Jahre hat sie die Mitgliederversammlungen des DAKBT souverän geleitet, manche hitzige Debatte durch eine klare Standortsbestimmung entschärft, um uns dann, ganz KBT gemäß, zu zeigen was der mögliche nächste Schritt sein könnte.
Durch ihre Arbeit an der Fachhochschule in Reutlingen war Ali schon in den 70er Jahren mit Supervision vertraut, was in der Anfangszeit des DAKBT nicht für alle selbstverständlich war. In den Folgejahren war sie für viele von uns als Supervisorin wichtig und hilfreich.
Auch in den 70er Jahren ermöglichte sie, durch die Verbindung zu „ihrer Forschungsstelle“ an der Fachhochschule, erste Versuche mit Video- Aufzeichnungen und KBT in Kirchberg zu machen. Sie hatte die Gelegenheit eine Videokamera auszuleihen, was damals sowohl beeindruckte als auch irritierte. Danach wurde das Projekt für längere Zeit zur Seite gelegt.
Mit der Zunahme der Mitgliederzahl des DAKBT nahmen auch die Konflikte zu. So wurde sie 1996 zur Ombudsfrau berufen. Dieses Amt hatte sie bis 2011 inne. 15 Jahre! Dann hat Rudolf Kost sie abgelöst.
Immer wieder konnte man erfahren: sie konnte zuhören und ihr Gegenüber ernst nehmen, und mit den Beteiligten angemessenen Lösungen finden.
Thea Schönfelder, ein ebenfalls verstorbenes Ehrenmitglied des DAKBT, nach Ali Maußhardt befragt, sagte 2009: „Ali ist verschwiegen, reell, unparteiisch und sie kann klar denken“.
Bis in ihr hohes Alter hatte Ali so manche Fäden in der Hand, familiäre und solche aus ihrer früheren KBT-Arbeit. Noch als 90jährige machte sie ihre regelmäßigen Besuche im Altenheim.
Ali war in den letzten Jahren mehrfach bei mir in Konstanz zu Gast - im Sommer und im Winter. Das Schwimmen im Bodensee genoss sie ganz besonders. Ich habe Ali in Erinnerung als eine Frau die auch im hohen Alter wusste, was sie will und dies auch durchzusetzen verstand. Sie konnte bis zu ihrem Lebensende selbstbestimmt leben.
Was will man mehr!
Konstanz, im August 2019
Dorothée Schmidt
Foto: fotodesignhorsthaas
Von der Bayerischen Landesärztekammer wurde diese Weiterbildungsreihe (50 Fobi-Punkte) zertifiziert. Sie bietet Ärzt*innen und Psycholog*innen die Möglichkeit, die Konzentrative Bewegungstherapie (KBT) entweder als „weiteres Verfahren“ für die Psycho-therapieweiterbildung oder zur Bereicherung der Berufspraxis zu nutzen. Körperpsychotherapeutisches Wissen wird in praktischen Angeboten erfahren und theoretisch reflektiert.
Ähnliche Möglichkeiten empfahlen zwei der Hauptreferenten, Herr Prof. Küchenhoff und Herr Prof. Henningsen während der diesjährigen Psychodynamischen Tage in Langeoog mit dem Thema : „Das Ich ist vor allem ein Körperliches“. Sie schätzten Erfahrungen in Körper-psychotherapie als wünschenswerten Ergänzung zur psychoanalytischen Weiterbildung ein und benannten hierfür die KBT als fundierte klinisch bewährte Methode.
Ulfried Geuter stellt zehn Grundprinzipien für die körperpsychotherapeutische Praxis dar, die den Geist, den Grund und die Intention, aus der heraus sich das Vorgehen gestaltet, beschreiben. An Hand von Therapiebeispielen aus seiner eigenen Praxis werden die Prinzipien lebendig. Er stellt sich als Person zur Verfügung, hier im Buch wie in seiner Praxis und vermittelt so einen lebendigen Einblick in seine therapeutische Arbeit.
Der Ansatz ist prozessorientiert: der Patient macht neue emotionale Erfahrungen, die ihm helfen, seine dysfunktionalen Muster des Erlebens und Verhaltens zu verändern. Prozessziele können unter anderem sein, sich selbst besser wahrzunehmen, einen Konflikt in einem Rollenspiel zu klären oder überschießende Affekte zu regulieren. Sie helfen, die (psychotherapeutischen) Ziele des Patienten zu erreichen.
Zur Beschreibung der zehn Prinzipien zieht er Literatur aus allen Richtungen der Körperpsychotherapie hinzu, so dass sich sowohl die KBT-Therapeutin als auch der Bioenergetiker dort wiederfinden können.
Übergeordnete Prinzipien der Psychotherapie wie Klärung und Konfrontation, Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte oder Lernen durch wiederholte Erfahrung finden in der Körperpsychotherapie ihre Anwendung, ebenso wie die Orientierung am Prozess und am Erleben. Zehn verfahrensspezifische Prinzipien beschreibt er in einzelnen Kapiteln: (1) Wahrnehmen und Spüren, (2) Gewahrsein und Gegenwart, (3) Erkunden und Entdecken, (4) Aktivieren und Ausdrücken, (5) Regulieren und Modulieren, (6) Zentrieren und Erden, (7) Berühren und Halten, (8) Inszenieren und Interagieren, (9) Verkörpern und Handeln und (10) Reorganisieren und Transformieren.
Atmen und Bewegen sind nicht in einem eigenen Prinzip benannt, Geuter betrachtet sie als Aspekte des Erlebens körperlicher Funktion. Hier hat die KBT einen anderen Begriff von Bewegung, der sowohl körperliche als auch seelische Bewegung umfasst und damit ein Prinzip verdient hätte.
Ein Kapitel ist der (Einzel-)Therapiestunde gewidmet. Für Geuter beginnt die Stunde in der Regel im Gespräch, ein Wechsel zu körperbezogener Arbeit entsteht im Prozess. Das Setting kann variieren vom Sitzen zum Stehen, Gehen oder Liegen. Der Raum und vielfältige Gegenstände können einbezogen werden.
Erleben und Erfahren sind in der Therapie von grundlegender Bedeutung, genauer: ein mit Bedeutung versehenes emotionales Erleben ist Schlüssel für Veränderung. Vertieftes Erleben ist ein Weg des Zugangs zu unbewussten Mustern, Selbsterleben erfolgt über das Körpererleben. Mit neuen Erfahrungen in der Therapiestunde können alte Muster korrigiert und die Fähigkeit zur Selbstregulation und Selbstreflexion verbessert werden.
Geuter wendet sich vehement gegen die Bezeichnung ‚nonverbale’ Therapie und setzt dagegen eine verkörperte erlebnisfördernde Sprache. Es geht ihm um den Prozess des gemeinsamen Suchens nach der Be-Deutung von Erfahrungen, nicht nach Deutung durch den Therapeuten. Er empfiehlt, Metaphern zu verwenden, Verben zu nutzen, die oft eine körperliche Anmutung haben, Fragen zu stellen (was lange in der Therapie verpönt war). Dieses Kapitel ist für mich erfrischend, da ich meine oft eher intuitive Praxis des therapeutischen Sprechens systematisch zusammengefasst und bestätigt finde.
Ein ausführliches Kapitel über die therapeutische Beziehung greift Ergebnisse der Psychotherapieforschung auf, wonach die Beziehung stärker wirkt als die angewandte Methode. Die Beziehung wird in der Körperpsychotherapie als verkörperte Begegnung von Subjet zu Subjekt verstanden, die vom Therapeuten Präsenz, Kontakt und differenzierte Rollenübernahme verlangen. Die Körperpsychotherapeutin sei wie eine ‚Hebamme, die hilft, ein Kind auf die Welt zu bringen, das von selbst kommt’, sie begleitet aktiv, sie braucht den Mut, zum richtigen Zeitpunkt in einen autonomen Prozess einzugreifen.
Das Buch wird abgerundet durch zwei Kapitel, die sich mit Wirkfaktoren und Wirkungen der Körperpsychotherapie beschäftigen.
Zusammenfassend kann ich dieses umfangreiche Kompendium der körperpsychotherapeutischen Praxis empfehlen, vor allem für ärztliche und psychologische approbierte Psychotherapeuten, die die Körperpsychotherapie in ihrer Praxis kreativ anwenden möchten. Zwei Mängel tun sich für mich auf: einerseits fehlt die Praxis der körperpsychotherapeutischen Gruppenarbeit völlig. Andererseits fehlt der Blick auf die Arbeit der in der Regel nicht approbierten Körperpsychotherapeuten in der Klinik. Sie können sicherlich von den zehn Prinzipien profitieren, aber in den fokussierten Kurzzeitbehandlungen in der Klinik muss das prozessorientierte Arbeiten sehr modifizieren werden.
Insgesamt ist das Buch ein großer Schritt auf dem Weg, für die verschiedenen Schulen eine gemeinsame Sprache zu finden.
Geuter Ulfried (2019) Praxis Körperpsychotherapie – 10 Prinzipien der Arbeit im therapeutischen Prozess. Springer Verlag, Heidelberg, ISBN 978-3-662-56595-7, 508 Seiten, € 49,99
Karin Schreiber-Willnow
Eine ausführliche Rezension findet sich in der Zeitschrift Psychotherapeut 2019, 64(4), 349-352: „Verkörperte Begegnung von Subjekt zu Subjekt“.
Der Artikel steht auch elektronisch unter seinem DOI zur Verfügung:
http://link.springer.com/article/10.1007/s00278-019-0356-y
Die Internationale Fachtagung für Konzentrative Bewegungstherapie findet dieses Jahr vom 10.-13. Oktober 2019 im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden statt.
Das Thema: "Die therapeutische Beziehung in der digitalen Welt"
Vorwort:
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Therapeutische Beziehungen waren lange Zeit geprägt durch Begegnungen zwischen Patient*in und Therapeut*in in einem gemeinsamen realen Raum. Durch die Zunahme der Digitalisierung scheint dieser Raum sich zu erweitern (oder eher zu verengen?)
Terminabsprachen, Befindlichkeitsberichte per Mail und SMS werden alltäglicher, Online-Therapien sind verfügbar und Patienten informieren sich umfassend im Internet.
Welche Auswirkungen hat dies auf die therapeutische Beziehung? Worauf haben wir Therapeut*innen uns schon unbemerkt eingestellt? Computerspiel- und PC-sucht werden im ICD 11 aufgenommen, die neurophysiologischen Auswirkungen werden erforscht.
Was heißt das alles für eine körperorientierte Psychotherapiemethode wie die Konzentrative Bewegungstherapie, in der Berührung, Arbeit mit und an der sinnlichen Wahrnehmung wesentlicher Bestandteil des therapeutischen Vorgehens ist?
Die Tagungsbeiträge befassen sich mit dem Spannungsfeld therapeutischer Beziehungen in der digitalen Welt und wir sind gespannt auf neue Forschungsergebnisse, praktische Therapieansätze und anregende Diskussionen mit Ihnen/Euch!
Ihre Barbara Bayerl und Marie-Louise Redel
Nähere Informationen, Vorträge, Workshops und die Anmeldung zur internationalen Fachtagung des DAKBT und EAKBT können Sie dem Programmheft entnehmen.
Programmheft Jahrestagung 2019 als PDF herunterladen/öffnen